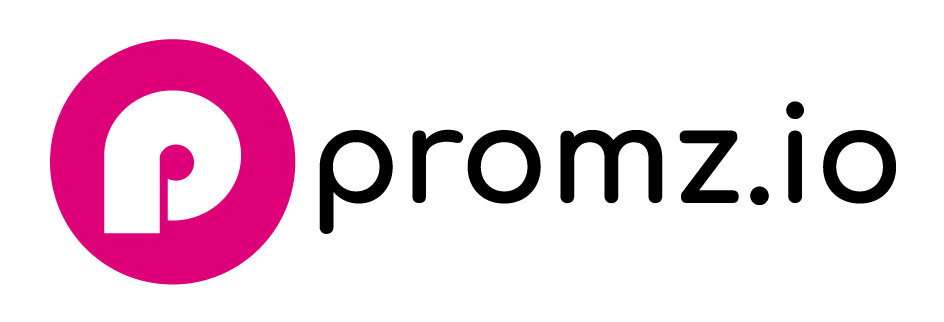Ursprünglich dem Alternative Country zugerechnet, verschieben Wilco seit Jahren musikalische Grenzen, überaus eigenwillig und in alle möglichen Richtungen. Das Ergebnis muss man nicht immer lieben, aber langweilig wird es nie. Nachdem sich die Band mit dem letzten Album «Cruel Country» (2022) auf ihre Wurzeln besonnen und damit die Herzen vieler Fans erfreut hat, folgt nun mit ihrem 13. Studioalbum «Cousin» eine Kehrtwende.
Obwohl Frontman Jeff Tweedy seit Jahren selbst Alben etlicher Musikgrößen produziert – von Mavis Staples über Richard Thompson bis Rodney Crowell -, greifen Wilco hier erstmals seit sehr langer Zeit wieder auf Hilfe von außen zurück. Und eine bessere Wahl als die walisische Musikerin und Produzentin Cate Le Bon, das zeigen alle zehn Songs auf «Cousin», hätte sie kaum treffen können.
Ausgefeilte Songs und viele Überraschungen
Auf dem unvermittelt aus Klangrauschen entstehenden Opener «Infinite Surprise» legt sich Soundschicht um Soundschicht über die heisere Stimme von Tweedy. «It’s good to be alive, it’s good to know we die», singt der, bevor das aufwühlende Stück unter disharmonischem Gitarrengeheul allmählich erstirbt und am Ende nur Störgeräusche hinterlässt.
An den Liedern hat die Band seit längerem gefeilt. Schon vor über einem Jahr – beim Erscheinen von «Cruel Country» – kündigte Tweedy «Cousin» als Art-Pop-Album an. «Ich denke, die Platte wird die Leute umhauen», sagte er damals in einem Interview. Das war nicht übertrieben: Jedes einzelne Stück ist kunstvoll arrangiert, mal orchestral-opulent, mal sparsam – von der nachdenklichen Ballade «Ten Dead» über das schon als Single ausgekoppelte «Evicted» mit seinem düsteren Strand-Feeling bis zum spröde rockenden Titelsong «Cousin».
Der Genremix zeigt die Qualität der Band, die scheinbar mühelos einzigartige Klanggebilde schafft, in denen jeder Ton seinen Platz hat. Wie sie die stark durcharrangierten Stücke so simpel wirken lässt, das ist große Kunst. «Das Erstaunliche an Wilco ist, dass sie alles sein können», sagt Produzentin Le Bon. «Sie sind so vielseitig, und es gibt eine Originalität, die alles durchzieht, was sie machen, egal welches Genre, egal welches Feeling.»
Besonders deutlich wird das in «Pittsburgh». Eine anfangs fast schüchtern gezupfte Akustikgitarre wird urplötzlich von einer bombastischen Soundwand überdröhnt, die das Stück majestätisch-träge dahinschweben lässt, bevor sie wieder verschwindet und Platz lässt für Tweedys brüchige Stimme, die später wiederum von einem groovigen Jazzpart abgelöst wird.
Die eigentlichen Überraschungen hat sich die Band für den Schluss aufbewahrt. Das beschwingte Westcoast-angehauchte «Soldier Child» mit Western-Flair ist ein für Wilco ungewöhnlich konventioneller Ohrwurm, toll in Szene gesetzt mit dezentem Gitarrensolo. Als wäre das nicht genug, legt die Band mit dem Closer «Meant to be» eine unbeschwerte, lupenreine Pop-Hymne mit Disco-Beat nach. Und wenn Tweedy am Ende singt «Our love was meant to be», wieder und wieder, angetrieben von galoppierenden Drums, dann ist das – nach dem ganzen vorangegangenen Weltschmerz – Erlösung pur.